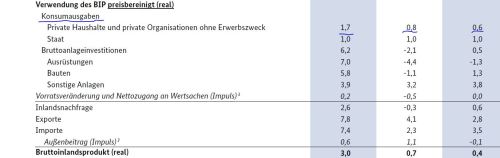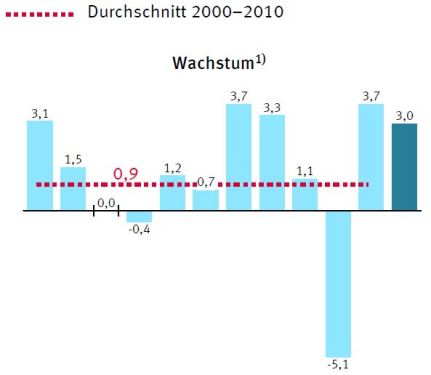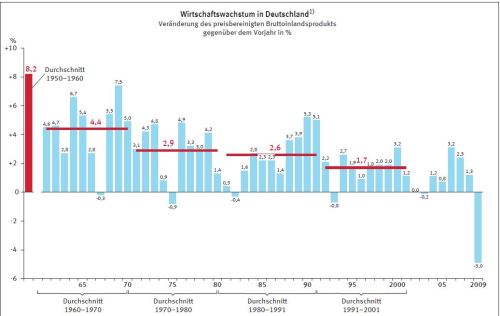Das Motto des Kirchentages lautete Soviel du brauchst. Es stand für Grundsätze wie, das richtige Maß finden, nicht über die Stränge schlagen und verantwortlich mit den Ressourcen umgehen. In Sachen Lohngerechtigkeit und Arbeitnehmerrechte weiß die Kirche, wie viel ihre Arbeitnehmer brauchen und was sie auf keinen Fall dürfen, denn, so Kirchentagspräsident Robbers, Mitarbeiter, die das Prinzip der Dienstgemeinschaft nicht mittragen könnten, sollten halt woanders arbeiten. So einfach ist das aber nicht.
Die Kirche ist ein ziemlich großer Arbeitgeber, der vor allem soziale Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Altenpflegeheime, Krankenhäuser und sogar Schulen betreibt, also öffentliche Aufgaben übernimmt. Rund 450.000 Menschen sind allein in den sozialen Einrichtungen der evangelischen Kirche beschäftigt. Bestens ausgebildete Fachkräfte, Pflegepersonal, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer können nicht mal eben woanders arbeiten, wenn Kommunen und Länder gleichzeitig einen immer tieferen Sinn in der engen Zusammenarbeit mit den Kirchen sehen.
Die mit Steuergeldern unterstützte Kooperation mag in den Augen vieler Vorteile haben, sie ist aber für Arbeitnehmer dann niemals voraussetzungslos. Neben der Eignung durch Qualifikation ist das Bekenntnis zum Glauben offenbar unabdingbar und immer auch Teil der Stellenbeschreibung. Außerdem wird Mitarbeitern in Führungspositionen schon mal nahegelegt, sich öffentlich zum christlichen Glauben zu bekennen, um damit das kirchliche Profil der Einrichtung auch nach außen hin stets erkennbar zu halten. Der Grund dafür kann nur der Wettbewerb sein, in den die Politik auch die Kirchen getrieben hat. Sie müssen sich gegenüber privaten Anbietern, die ganz klar auf Profitmaximierung setzen, behaupten.
Doch was ist, wenn sich Mitarbeiter nur pro forma zum Glauben bekennen, weil sie es müssen, um den Job zu bekommen? Kann sich die Kirche dann überhaupt auf die im Grundgesetz verbrieften Sonderrechte berufen? Während sich Gewerkschaften und Kirchenvertreter über diese Frage streiten, hält sich die Politik freilich heraus und erklärt sich für nicht zuständig. Sowohl Kanzlerin Merkel als auch ihr Herausforderer Wahlhelfer Peer Steinbrück nutzten die Plattform Kirchentag, um Wahlkampf in eigener Sache zu führen. Die eine sprach von der Energiewende unter dem albernen Stichwort Schöpfung in der globalisierten Welt und der andere über eine schärfere Bankenregulierung.
Die Schlagzeilen zum Thema Lohn liefern beide aber nicht, sondern ausgerechnet die FDP auf ihrem Parteitag im fernen Nürnberg. Dabei hat diese marktradikale Splitterpartei überhaupt nichts beschlossen, was es nicht schon gibt. Dennoch plappern die Medien eine Agenturmeldung nach, wonach sich die Liberalen einer moderaten Öffnung bei Mindestlöhnen hingegeben hätten. So ein Blödsinn. Rösler versucht nur auf der Basis des Bestehenden alles, um sich und seine verkommene Partei über die 5-Prozent-Hürde zu hieven.
Zum Beispiel muss die Regierungs-FDP den gerade im Friseurhandwerk ausgehandelten Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro für allgemeinverbindlich erklären. So steht es im Arbeitnehmerentsendegesetz, das bereits in vielen Branchen Mindestarbeitsbedingungen regelt. Wenn die FDP also öffentlichkeitswirksam über Mindestlöhne streitet, um dann ein politisches Programm zu verabschieden, das vorschlägt jene Regelungen umzusetzen, die bereits jetzt durch Schwarz-Gelb angewendet werden, so kann man nur von einem durchschaubaren Theater sprechen. Der FDP geht es dabei nur um ein verbessertes Image, nicht aber um eine bessere Politik.
Denn auch die Liberalen finden, dass in Sachen Lohnpolitik niemand, außer ihresgleichen, über die Stränge schlagen sollte, weil es die Ressource Arbeit angeblich gefährde. Und wer findet, zu wenig zu verdienen, soll doch einfach woanders hingehen, in eine andere Stadt vielleicht und zu einem anderen Betrieb. So einfach ist das aber nicht.
MAI