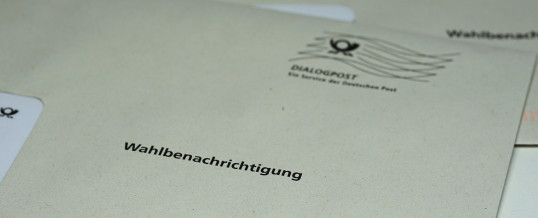
Wir brauchen dringend eine Wahlrechtsänderung. Der Bundestag ist viel zu groß. Derzeit sind es 709 Abgeordnete, künftig könnten es noch mehr werden, da weitere Ausgleichsmandate für die zunehmenden Überhangmandate der Union erforderlich werden. Das Wachstumsproblem des Bundestages ist schon lange bekannt. Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert hatte bereits in der vergangenen Legislaturperiode auf eine Änderung des Wahlrechts gedrungen, scheiterte aber mit seinem Vorschlag. Eine Lösung böte die Abschaffung der Erststimme. Sie ist unsinnig, nur schwer verständlich und daher überflüssig.
Zunächst einmal suggeriert die Erststimme dem Wähler, sie sei die wichtigere, weil sie als erstes kommt. Das klingt jetzt furchtbar einfältig, ist aber tatsächlich immer wieder erklärungsbedürftig. Denn über die Zusammensetzung des Parlaments entscheidet die Erststimme nun einmal nicht. Der Anteil der Zweitstimmen ist maßgeblich für die Sitzverteilung im Bundestag. Mit der Erststimme wird hingegen ein Direktkandidat gewählt und auch nur der Gewinner mit einem sicheren Sitz belohnt. Die Stimmen für die unterlegenen Kandidaten entfallen.
Über die Liste gut abgesichert
Das heißt aber nicht, dass die anderen Bewerber ihr geplantes Leben als Abgeordnete an den Nagel hängen müssten. Im Gegenteil. Häufig sind viele Direktkandidaten über die jeweiligen Landeslisten ihrer Parteien so gut abgesichert, dass sie trotzdem in den Bundestag einziehen. Ein Extrembeispiel liefert mein Wahlkreis Hannover Land I. Zur Bundestagswahl 2017 traten hier sieben Kandidaten an. Fünf davon sitzen jetzt auch im Bundestag.
Hendrik Hoppenstedt (CDU) ist der direkt gewählte Abgeordnete. Caren Marks (SPD), Grigorios Aggelidis (FDP), Diether Dehm (die Linke) und Dietmar Friedhoff (AfD) bewarben sich ebenfalls um das Direktmandat, hatten aber beim Rennen um die Erststimme das Nachsehen. Die vier sind trotzdem Mitglieder des Bundestages, weil sie auf den Listen ihrer Parteien gute Plätze einnahmen und daher aufgrund des Zweitstimmenergebnisses ihrer Partei relativ problemlos den Sprung ins Parlament schafften.
Sind sie jetzt weniger Wahlkreisabgeordnete als der Sieger Hoppenstedt, der inzwischen zu Merkels Staatsminister geworden ist? Nein. Mit dem Direktmandat sind keinerlei besondere Rechten und Pflichten verbunden. Jedes Mandat, ob direkt errungen oder über die Liste verteilt, ist gleichrangig. Den Parlamentariern steht es auch frei, sich für die Belange ihrer Wahlkreise zu engagieren, obwohl sie per Definition Vertreter des gesamten Volkes zu sein haben.
Unterm Strich könnte man für den speziellen Fall des Wahlkreises Hannover Land I auch sagen, dass die Erststimmenwahl keinerlei Einfluss auf die personelle Zusammensetzung des Bundestages hatte, da ein Großteil der Kandidaten per Zweitstimme ohnehin gewählt worden wäre. Man hätte hier also getrost auf die Erststimme verzichten können. Generell gilt das aber auch, da die direkt gewählten Abgeordneten mit den Kandidaten auf den jeweiligen Landeslisten ihrer Parteien verrechnet werden.
Alberne Reformvorschläge
Wenn nun aber mehr Direktmandate errungen werden als nach Zweitstimmenanteil der jeweiligen Partei an Sitzen zustehen, wird es kompliziert. Es entstehen Überhangmandate, da die Gewinner der Wahlkreise auf jeden Fall einen Sitz im Parlament erhalten. Um das Kräfteverhältnis nach dem Zweitstimmenergebnis zu wahren, bekommen die anderen Fraktionen laut der Wahlrechtsreform von 2013 automatisch Ausgleichsmandate. Nachteil: Die Anzahl der Sitze des Bundestages steigt.
Nun gibt es viele Lösungsvorschläge unter Beibehaltung von Erst- und Zweitstimmen, die das Verständnis für das Wahlsystem als Ganzes aber noch schwieriger machen würden. Glaubt man Umfragen, verstehen schon heute zwischen 30 und 40 Prozent der Bürger das deutsche Wahlrecht nicht. Daher wäre beispielsweise der Vorschlag von Thomas Oppermann, noch eine dritte Stimme einzuführen, eine für den Mann, eine für die Frau und eine für die Partei der vermutlich allergrößte Unfug.
Man fragt sich, was die Verknüpfung der Wahlrechtsdiskussion mit dem Frauenanteil eigentlich soll. Für die Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten sind doch die Parteien selbst verantwortlich. Wenn sie Männer bevorzugen, müssen sie halt weiterhin mit der Kritik leben. Als es nach der Bundestagswahl um die Verteilung von Posten ging, wurde Thomas Oppermann mit dem Amt des Bundestagsvizepräsidenten bedacht, obwohl zuerst zwei Kandidatinnen zur Verfügung standen und die SPD eigentlich junge, weibliche und unverbrauchte Gesichter nach vorne rücken wollte.
Mehr Stimmen bringen da jedenfalls keine Lösung und sie ändern auch nichts an dem armseligen wie blamablen Postengeschacher, bei dem die fachliche Eignung eine noch geringere Rolle spielt, als das Geschlecht. Aus diesem Grund wäre der Vorschlag zu einer Stimme im Wahlrecht zurückzukehren, mit der sowohl der Wahlkreiskandidat als auch die jeweilige Partei gewählt würde, der sinnvollste und einfachste Weg. Das gab es bereits bei der ersten Bundestagswahl 1949.
Änderung der Geschäftsordnung
Allerdings sind auch mit nur einer Stimme Überhangmandate weiterhin möglich, weil die größeren Parteien tendenziell immer seltener gewählt werden. Das heißt, man hätte immer noch das Problem, dass CDU und CSU nahezu alle Wahlkreise gewinnen, aber bei weitem nicht auf 50 Prozent Zustimmung kommen. Eine Verringerung der Wahlkreise könnte da vielleicht die Lösung bringen. Ganz unumstritten ist aber auch das nicht.
Alternativ könnte man aber auch solche Abgeordnete einfach aus dem Bundestag schmeißen, die durch allerlei Nebentätigkeiten auffallen und sich damit eher ausgewählten Einzelbelangen verbunden fühlen, als den Interessen der Allgemeinheit. Sie wären mit einem Lobbyistenausweis vielleicht besser bedient, als mit dem Abgeordnetenmandat.
„Von den 709 Bundestagsabgeordneten verfügen 154 über bezahlte Nebentätigkeiten, also mehr als jeder fünfte Parlamentarier. In vielen Fällen ergeben sich daraus potentielle Interessenkonflikte.“
Quelle: abgeordnetenwatch
Fielen diese Abgeordneten weg, wäre der Bundestag sogar kleiner als die bekannte Sollgröße von 598. Natürlich ist das eine Spinnerei, wie die Diskussion um das Wahlrecht übrigens auch, die schon wieder in einer Sackgasse zu enden droht. Es wird sich vermutlich nichts ändern, weil die Interessen der Parteien eine noch viel größere Rolle spielen. Dann sollte es aber wenigstens eine Änderung der Geschäftsordnung geben.
„Wie wäre es mit einer kleinen Änderung der Bundestagsgeschäftsordnung? Ab sofort nennt jeder Redner im Bundestag zu Beginn seiner Wortmeldung nicht nur seinen Namen, sondern auch seine Nebentätigkeiten und Beraterverträge. Die Auflistung geht von der Redezeit ab. Wenn noch etwas übrig ist, darf er reden. Das würde uns helfen, den tieferen Sinn der Rede besser zu verstehen.“
Georg Schramm, in: „Lassen Sie es mich so sagen…“, Seite 140
MäRZ

Über den Autor:
André Tautenhahn (tau), Diplom-Sozialwissenschaftler und Freiberuflicher Journalist. Seit 2015 Teil der NachDenkSeiten-Redaktion (Kürzel: AT) und dort mit anderen Mitarbeitern für die Zusammenstellung der Hinweise des Tages zuständig. Außerdem gehört er zum Redaktionsteam des Oppermann-Verlages in Rodenberg und schreibt für regionale Blätter in Wunstorf, Neustadt am Rübenberge und im Landkreis Schaumburg.