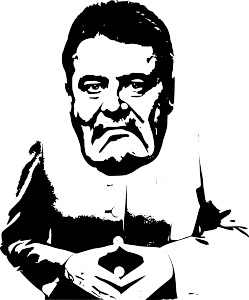
Quelle: pixabay
„Deutschland braucht jetzt ein Bündnis aller progressiven Kräfte.“ So lautet die neueste Botschaft des SPD-Parteichefs Sigmar Gabriel, die im aktuellen Spiegel nachzulesen ist. Das heißt übersetzt: SPD, Linke und Grüne sollen sich zusammentun, um gegen den Aufstieg der Rechten etwas zu unternehmen. Wie glaubwürdig diese Neupositionierung ist, muss sich erst noch zeigen. Denn vor gut einem Monat fand es der SPD-Chef noch selbst erstaunlich, welche Fantasien man auslöse, wenn man ein entspanntes Verhältnis zu jemanden habe, mit dem man politisch derzeit nicht allzu viel gemeinsam hat. Gemeint war Oskar Lafontaine, mit dem sich Gabriel traf.
Nun lässt Gabriel seiner Fantasie freien Lauf, nachdem er bereits gefordert hat, seine Partei müsse radikaler werden.
Politischer Überlebenskampf
Im Angesicht fallender Zustimmungswerte sucht Gabriel nach einer Möglichkeit, wie das derzeitig verantwortliche SPD-Personal politisch überleben kann. Er sucht aber auch nach einer Fortsetzung neoliberaler Politik mit anderen Mehrheiten. Indem der SPD-Parteichef mehr Kampfbereitschaft von der demokratischen Linken einfordert, ruft er im Prinzip ja die Linke und Grüne dazu auf, endlich regierungsfähig und bündnisbereit zu werden. Die SPD ist es ja schon immer gewesen, so scheint es. Die anderen sind es aus Sicht von Gabriel aber nicht. Denn wären sie es, könnte er bereits morgen Kanzler sein.
Für ein dringend benötigtes „Bündnis aller progressiven Kräfte“ braucht der SPD-Chef nämlich keine Fantasie, sondern lediglich ein konstruktives Misstrauensvotum im Deutschen Bundestag. Das Grundgesetz und die Mehrheitsverhältnisse lassen die Anwendung des bereits erprobten demokratischen Mittels auch jetzt immer noch zu. Doch diesen einfachen Zugang zur progressiven Machtoption strebt Sigmar Gabriel gar nicht an, eben weil er das von den Linken denkt, was er und seine Genossen schon immer dachten. Nicht regierungsfähig, weil außen- und haushaltspolitisch unberechenbar. Heißt: Nur die SPD bestimmt, wer regierungsfähig ist und wer nicht.
Das ganze Getue entbehrt aber nicht einer gewissen Ironie. Denn wie oft betonten Gabriel und Steinbrück während des letzten Bundestagswahlkampfes die Ablehnung eines rot-rot-grünen Regierungsbündnisses. Unterstützt wurden sie dabei durch eine breite Medien-Allianz. Es wäre nicht nur der Bruch eines Wahlversprechens, sondern ein noch größeres Risiko für die SPD, die dann als Volkspartei sicher unterzugehen drohe, orakelten die Edelfedern. Doch heute, knapp drei Jahre später, ist dieser befürchtete Abstieg in die politische Bedeutungslosigkeit an der Seite von Mutti Merkel längst Realität geworden.
Dagegen wehrt sich nun der SPD-Chef, der seine 75-Prozent-Wiederwahl zum Parteichef im Dezember 2015 noch trotzig als Zustimmung zu seinem Kurs verstand, mit einem Appell an die nicht näher bestimmten progressiven Kräfte, um nicht zugeben zu müssen, dass die Wiederauflage der Großen Koalition ein Fehler war. Stattdessen wirft Gabriel der Union Entkernung vor, ohne auf die Substanzlosigkeit seiner SPD zu sprechen zu kommen. Damit lenkt er ein weiteres Mal vom Versagen der eigenen Führungsmannschaft ab.
Selbstlob statt Selbstkritik
Statt Selbstkritik dominiert Selbstlob. Die SPD zählt auf, was sie in der Großen Koalition alles auf den Weg gebracht habe. Wenn eine Putzfrau dann aber fragt, wo das soziale Profil bei den vielen Kompromissen in der Regierung eigentlich geblieben ist, antwortet der Parteichef achselzuckend, mit den Schwatten war halt nicht mehr drin. Dabei hätte er sagen müssen, mit den Roten, die noch immer die Agenda 2010 als ein Qualitätssiegel sozialdemokratischer Politik empfinden und nach außen verkaufen, war und ist auch in Zukunft keine Alternative zum neoliberalen Umbau der Gesellschaft drin.
Wäre Gabriel ehrlich, würde er nicht der Union den Aufstieg der Rechtspopulisten ankreiden, sondern den Totalausfall der deutschen Sozialdemokratie als Ursache erkennen. Er müsste sich eingestehen, dass das Bekenntnis zum neoliberalen Zeitgeist, beginnend mit dem Schröder-Blair-Papier, einen radikalen Kurswechsel darstellte, der die Fantasie und Leidenschaft vieler sozialdemokratisch denkender Menschen auf dem Altar reiner Karriereinteressen opferte. Seit der Wahl von 1998 hat die SPD über zehn Millionen Stimmen verloren. Daran sind nicht Union oder Wölfe im Tweedsakko schuld, sondern eine SPD-Parteiführung, die sich in der eigenen Fantasiewelt eingerichtet hat.
Die Spitzensozialdemokraten merken bis heute nicht, dass sie sich für Partikularinteressen haben bereitwillig einspannen lassen. Beispielhaft dafür ist noch immer der Auftritt von Frank-Walter Steinmeier vor dem Deutschen Arbeitgebertag 2013. Damals spulte der Architekt der Agenda 2010 und heutige Lieblingskandidat für die Nachfolge des Bundespräsidenten die geleistete Reformpolitik von SPD und Grünen mit dem Gehabe eines Managers ab, um den anwesenden Arbeitgebervertretern zu beweisen, wie wichtig die SPD-Führung deren Interessen nimmt. Steinmeier verband sein Selbstlob dann noch mit der Verwunderung darüber, dass viele Arbeitgeber sich dennoch lieber bei der Union verorten würden als bei der SPD.
Ein Kurswechsel, der die Interessen des kleinen Mannes wieder stärker in den Blickpunkt rückt, ist sicher vorstellbar, aber nicht mit dem Personal, das den Niedergang der ehemaligen Volkspartei SPD über Jahre hinweg zu verantworten hat und dennoch keine Einsicht zeigt. Noch unmittelbar nach den katastrophalen Landtagswahlen vom 13. März tönten Gabriel und sein Mitstreiter Thomas Oppermann, das man an dem Kurs der SPD nichts ändern müsse. Und das wollen sie in Wirklichkeit auch nicht. Die anderen, die progressiven Kräfte, sollen das erledigen, um regierungsfähig zu sein. Nein, Glaubwürdigkeit könnte erst dann wieder entstehen, wenn die verbohrten Ideologen endlich gehen und ein überzeugendes linkes Programm mit neuen Köpfen, die eine echte Alternative darstellen, verknüpft würde. Doch Leute wie Corbyn oder Sanders sind hierzulande weit und breit nicht in Sicht.
JUNI

Über den Autor:
André Tautenhahn (tau), Diplom-Sozialwissenschaftler und Freiberuflicher Journalist. Seit 2015 Teil der NachDenkSeiten-Redaktion (Kürzel: AT) und dort mit anderen Mitarbeitern für die Zusammenstellung der Hinweise des Tages zuständig. Außerdem gehört er zum Redaktionsteam des Oppermann-Verlages in Rodenberg und schreibt für regionale Blätter in Wunstorf, Neustadt am Rübenberge und im Landkreis Schaumburg.